Ein Beitrag zur Überbevölkerung in Facebook und
eine kluge Antwort darauf
Quelle und Link zur Facebook-Gruppe „Überbevölkerung – Geburtenstopp Jetzt! * Overpopulation – Birth Stop Now!“: https://www.facebook.com/groups/4293123190707124
Link zur Geburtenstopp-Petition in 16 Sprachen: https://www.change.org/p/%C3%BCberbev%C3%B6lkerung-globaler-geburtenstopp-jetzt-overpopulation-global-birth-stop-now
Wir brauchen dringend Globale Geburtenregelungen – Stichworte „Überbevölkerung“ und „Probleme“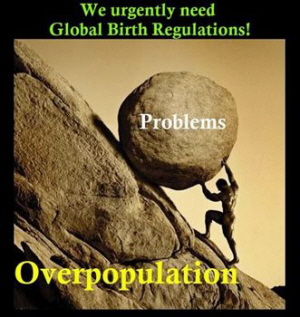
Antwort von Steven Earl Salmony
Seit dem 11.11.2011 habe ich jedes Jahr am 11.11. meine Sichtweise zur Bevölkerungsdynamik bekräftigt. Bitte haben Sie etwas Geduld mit mir.
Meine Arbeit zur Bevölkerungsdynamik basiert auf einer provokanten und wissenschaftlich fundierten Behauptung: Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ist die unabhängige Variable, die das Bevölkerungswachstum antreibt, und nicht umgekehrt. Diese Ansicht stellt die gängige Meinung in Frage, dass die Menschheit die Nahrungsmittelproduktion kontinuierlich steigern muss, um eine ständig wachsende Bevölkerung zu ernähren. Stattdessen lautet das Argument: Die Bevölkerungsgröße hängt funktional von der Menge der für den menschlichen Verzehr verfügbaren Nahrungsmittel ab – eine Dynamik, die paradoxerweise genau das Problem verschärft, das sie zu lösen versucht.
Ausgehend von ökologischen Theorien, der Thermodynamik und den Forschungen von Populationsökologen wie Russ Hopfenberg und David Pimentel stützt sich diese Sichtweise auf grundlegende biologische Gesetze. Bei jeder Spezies steigt oder sinkt die Populationszahl in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Ressourcen – insbesondere von Nahrung. Wenn mehr Nahrung verfügbar ist, wächst die Population, bis sie die Tragfähigkeit ihrer Umwelt erreicht oder überschreitet. Der Mensch ist trotz seiner technologischen Raffinesse von diesem ökologischen Prinzip nicht ausgenommen. Die massive Ausweitung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion seit der Agrarrevolution und insbesondere seit der Grünen Revolution hat ein exponentielles Wachstum der Weltbevölkerung ermöglicht, was wiederum eine weitere Ausweitung der Nahrungsmittelversorgung erfordert – ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der als „Nahrungsmittel-Bevölkerungs-Rückkopplungszyklus” bezeichnet wird.
Aus dieser Perspektive sind Bemühungen zur Beseitigung des Hungers durch intensivierte Landwirtschaft – obwohl moralisch überzeugend – ökologisch fehlgeleitet. Die Erhöhung der Nahrungsmittelverfügbarkeit zur Deckung der Nachfrage stabilisiert die Bevölkerung nicht, sondern stimuliert weiteres Wachstum. Das Ergebnis ist eine „thermodynamische Falle“: Jeder Versuch, die Nahrungsmittelknappheit durch höhere Produktion zu lösen, führt zu einer größeren ökologischen Überlastung, Umweltzerstörung und künftiger Knappheit. Die Abhängigkeit der industriellen Landwirtschaft von fossilen Brennstoffen, die Erschöpfung der Grundwasservorkommen, die Entwaldung und die Treibhausgasemissionen sind Symptome eines Systems, das über die nachhaltigen Grenzen unseres Planeten hinausgewachsen ist.
Diese Analyse betrachtet die Nahrungsmittelproduktion nicht mehr nur als humanitäre Reaktion auf das Bevölkerungswachstum, sondern als dessen treibende Kraft. Ich sehe darin ein globales Beispiel für ein bekanntes ökologisches Phänomen: Wenn eine Spezies ihre Nahrungsnische künstlich erweitert, überschreitet ihre Population die Tragfähigkeit der Umwelt, was unweigerlich zum Zusammenbruch führt. Die Tragik besteht darin, dass der technologische Erfindungsreichtum der Menschheit – der eigentlich dazu dienen sollte, die Knappheit zu überwinden – die natürlichen Rückkopplungskontrollen beseitigt hat, die einst das Gleichgewicht zwischen der Bevölkerung und der Biosphäre aufrechterhielten. Wir verbrauchen also unser ökologisches Kapital – Bodenfruchtbarkeit, Süßwasserreserven und atmosphärische Stabilität –, um das derzeitige Bevölkerungsniveau aufrechtzuerhalten.
Die politischen Implikationen dieser Sichtweise sind tiefgreifend und politisch unbequem. Wenn Nahrung die unabhängige Variable ist, dann erfordert eine langfristige Stabilisierung der Bevölkerungszahl, dass man sich mit den Grenzen der Nahrungsmittelproduktion auseinandersetzt und nicht nur die Verteilung oder die Erträge verbessert. Das bedeutet nicht, dass man die Nahrungsmittelhilfe einstellen oder Entbehrungen fördern soll, sondern vielmehr, dass man die globalen Systeme umstrukturieren muss, um den menschlichen Konsum an die ökologischen Grenzen anzupassen. Dazu gehört der Übergang von der industriellen Landwirtschaft zu regenerativen, ressourcenschonenden Systemen, die die natürlichen Kreisläufe respektieren, sowie die Integration freiwilliger Familienplanung und Aufklärung in die Nachhaltigkeitspolitik.
Letztendlich definiert diese Position die Ernährungssicherheit nicht mehr als eine Frage der Produktion von „genug“, sondern als eine Frage des Verständnisses von „genug für wie viele“. Diese Sichtweise warnt davor, dass die Ignorierung der biophysikalischen Beziehung zwischen Nahrung und Bevölkerung zu einer Zukunft führt, die von Krisen und Korrekturen geprägt ist – Umweltzerstörung, Massenmigration und menschliches Leid. Die zentrale Botschaft ist hart, aber klar: Je mehr Nahrung verfügbar ist, desto mehr Menschen muss der Planet ernähren, bis ökologische Grenzen ihre eigene Korrektur erzwingen. Um echte Ernährungssicherheit zu erreichen, muss die Menschheit anerkennen, dass ein nachhaltiges Bevölkerungsniveau nicht durch endlose Expansion entsteht, sondern dadurch, dass wir innerhalb der Energie- und Ressourcenströme leben, die die Erde kontinuierlich aufrechterhalten kann.
Original in Englisch:
Every year since 11/11/11, I have reiterated on 11/11 my view of human population dynamics. Please bear with me.
My work on population dynamics centers on a provocative and scientifically grounded assertion: food availability is the independent variable driving population growth, not the other way around. This view challenges the mainstream belief that humanity must continuously increase food production to feed an ever-expanding population. Instead, the argument is this: population size is functionally dependent on the amount of food made available for human consumption—a dynamic that, paradoxically, fuels the very problem it seeks to solve.
Drawing from ecological theory, thermodynamics, and the research of population ecologists such as Russ Hopfenberg and David Pimentel, this point of view situates my reasoning in basic biological law. In every species, population numbers tend to rise or fall according to resource availability—particularly food. When more food becomes accessible, populations increase until they reach or exceed the carrying capacity of their environment. Humans, despite their technological sophistication, are not exempt from this ecological principle. The massive expansion of global food production since the Agricultural Revolution and especially the Green Revolution has enabled exponential human population growth, which in turn demands further expansion of food supply—a self-reinforcing loop called a “food-population feedback cycle.”
From this perspective, efforts to eradicate hunger through intensified agriculture—though morally compelling—are ecologically misguided. Increasing food availability to meet demand does not stabilize population; it stimulates further growth. The result is a “thermodynamic trap”: each attempt to solve food scarcity by producing more leads to greater ecological overshoot, environmental degradation, and future scarcity. Fossil-fuel-dependent industrial agriculture, aquifer depletion, deforestation, and greenhouse gas emissions are the symptoms of a system that has expanded beyond sustainable planetary limits.
This analysis recasts food production as a driver of population growth, not merely a humanitarian response to it. I view this as a global-scale instance of a well-known ecological phenomenon: when a species artificially expands its food niche, its population overshoots the environment’s carrying capacity, followed inevitably by collapse. The tragedy is that humanity’s technological ingenuity—intended to conquer scarcity—has removed natural feedback controls that once kept population in balance with the biosphere. We are thus consuming our ecological capital—soil fertility, freshwater reserves, and atmospheric stability—to maintain present population levels.
The policy implications of holding this view are profound and politically uncomfortable. If food is the independent variable, then long-term population stabilization requires addressing food production limits, not simply improving distribution or yields. That does not mean withdrawing food aid or promoting deprivation, but rather restructuring global systems to align human consumption within ecological boundaries. This involves shifting from industrial agriculture toward regenerative, low-input systems that respect natural cycles, and integrating voluntary family planning and education into sustainability policy.
Ultimately, this position reframes food security not as a question of producing “enough,” but of understanding “enough for how many.” This point of view warns that ignoring the biophysical relationship between food and population leads to a future of crisis-driven correction—environmental collapse, mass migration, and human suffering. Its central message is stark but clear: the more food made available, the more humans the planet must support, until ecological limits impose their own correction. To achieve true food security, humanity must acknowledge that sustainable population levels arise not from endless expansion, but from living within the energy and resource flows the Earth can continuously sustain.
Achim Wolf, Deutschland
* Veröffentlicht in der Sonderausgabe FIGU-Zeitzeichen Nr. 178
 Print
Print
